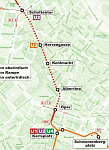Quelle: Osservatorio Balcani e Caucaso
Europa verliert einen ganz Großen! Der Urbanologe, Schriftsteller und ehemalige Belgrader Bürgermeister Bogdan Bogdanović ist heute 87-jährig in einem Wiener Spital verstorben.
Bogdan Bogdanović wurde am 20. August 1922 in Belgrad geboren. Nach dem Studium der Architektur und einer raschen akademischen Karriere stieß er mit seinen progressiven Lehrmethoden sehr bald an die Grenzen des jugoslawischen Universitätsbetriebs. Von der Partei zum Rücktritt gezwungen, kehrte er der Belgrader Universität den Rücken und gründete 1976 in Mali Popovic, unweit von Belgrad, eine “Dorfschule für die Philosophie der Architektur”.
Von 1982 bis 1986 war Bogdanović Bürgermeister von Belgrad. Nach dem Machtantritt von Slobodan Milošević und, damit verbunden, dem sich ausbreitenden Nationalismus war Bogdanović zunehmend öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt. 1993 musste der politisch Bedrohte seine Stadt, musste er Belgrad endgültig verlassen. Seitdem lebte er als Dissident in Wien.
Als Architekt war er vor allem durch die zahlreichen Denkmal-Bauten bekannt geworden, die er im gesamten Jugoslawien errichten ließ. Zwischen 1952 und 1981 entwarf Bogdan Bogdanović mehr als 20 Denkmäler und Gedenkstätten gegen Faschismus und Militarismus.
Ich persönlich verdanke Bogdan Bogdanović zu einem großen Teil meine Liebe zu Urbanistik und Architektur. Sein Text Vom Glück in den Städten gehört für mich zu den wichtigsten Büchern, die ich je gelesen habe. Städte zu lesen, das war für Bogdanović ein sinnlich-poetischer Vorgang: die Architektur atmen, den Erinnerungen der Bewohner lauschen, den Mythen der Geschichte nachspüren.
Und all das stets zu Fuß oder, wie er es nannte, nach der “Johnnie-Walker-Methode”.
[Ö1: Bogdan Bogdanovic gestorben]
[NZZ: Eros und Thanatos]
[Osservatorio Balcani e Caucaso: Il secolo di Bogdanovic]