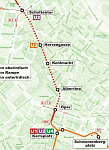1980: Ökologie. 2009: Internet. So prägnant und treffend hat der deutsche Journalist, Blogger und Podcaster Philip Banse letzte Woche in einem Tweet jene gesellschaftspolitische Entwicklung zusammengefasst, die in den letzten Monaten zu beobachten ist. Es geht um den Wandel der Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen. Besonders deutlich zum Ausdruck gekommen ist dieser Wandel im Rahmen zweier Themen: der deutschen Zensursula-Debatte und dem Prozess der Grünen Vorwählerschaft in Wien.
Im Januar 2009 gab die Familienministerin Ursula von der Leyen bekannt, dass die deutsche Bundesregierung plant, in Zusammenarbeit mit den großen Internetprovidern und durch den Einsatz einer Sperrliste den Zugriff auf kinderpornographische Inhalte einzuschränken. Greift ein Internetbenutzer auf eine Webseite zu, deren DNS-Name sich auf dieser Sperrliste befindet, wird ihm ein Stoppschild mit verschiedenen Warnhinweisen angezeigt; mit einem weiteren Klick gelangt er dennoch zur ursprünglich aufgerufenen Seite.
… es wäre so, als ob man die Straße zu einem Banküberfall sperrt, statt dass die Polizei zur Bank fährt.
Mit solchen Vergleichen (hier aus einer  bei einer Demonstration, die am 20. Juni in Berlin stattgefunden hat) versucht die Internetgemeinde zu veranschaulichen, welch absurden Prozess die geplante Filterung der Webseiten darstellt. Durch bloßes Ausblenden wird Kinderpornographie nicht verhindert, sondern toleriert. Warum verfolgt die Exekutive die Anbieter dieser Inhalte nicht? Der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur hat
bei einer Demonstration, die am 20. Juni in Berlin stattgefunden hat) versucht die Internetgemeinde zu veranschaulichen, welch absurden Prozess die geplante Filterung der Webseiten darstellt. Durch bloßes Ausblenden wird Kinderpornographie nicht verhindert, sondern toleriert. Warum verfolgt die Exekutive die Anbieter dieser Inhalte nicht? Der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur hat  gezeigt, wie einfach das sein kann1. Ist die Kinderpornographie nur ein Vorwand um im Internet ungehindert eine Zensurinfrastruktur errichten zu können?2
gezeigt, wie einfach das sein kann1. Ist die Kinderpornographie nur ein Vorwand um im Internet ungehindert eine Zensurinfrastruktur errichten zu können?2
Interessant ist nun, wie sich der Widerstand gegen die geplanten Zensurmaßnahmen organisiert hat. Während die etablierten Oppositionsparteien aus Angst, sie würden dadurch in der öffentlichen Darstellung in ein pädophilenfreundliches Eck gedrängt, davor zurückgeschreckt sind, sich eindeutig zu deklarieren, formierte sich im Internet unter dem Schlagwort „Zensursula“ der Widerstand. Soziale Netzwerke wurden als Diskussionsplattform und zur Organisation verschiedener Gegenmaßnahmen genutzt. In einer  Petition gegen Internetsperren sprachen sich über 130.000 Menschen öffentlich gegen die geplanten Maßnahmen aus.
Petition gegen Internetsperren sprachen sich über 130.000 Menschen öffentlich gegen die geplanten Maßnahmen aus.
Eine ähnliche Bewegung abseits der institutionalisierten Politik ist im Rahmen der  Grünen Vorwahlen auch in Wien zu beobachten. Auf Initiative von
Grünen Vorwahlen auch in Wien zu beobachten. Auf Initiative von  Jana Herwig,
Jana Herwig,  Helge Fahrnberger und
Helge Fahrnberger und  Martin Schimak gestartet, basiert die Idee der Grünen Vorwahlen auf einem
Martin Schimak gestartet, basiert die Idee der Grünen Vorwahlen auf einem  Statut der Wiener Grünen, demzufolge erklärte Unterstützer und Unterstützerinnen der Partei nach Viermonatsfrist ein Stimmrecht auf Landesversammlungen erhalten. Ziel ist es, die Grünen zu öffnen und möglichst viele Sympathisanten zu motivieren im November 2009 bei der Wahl der Liste für die Gemeinderatswahl 2010 teilzunehmen. „Damit dann die „Besten“ und „Fähigsten“ im Landesparlament sitzen.“ (
Statut der Wiener Grünen, demzufolge erklärte Unterstützer und Unterstützerinnen der Partei nach Viermonatsfrist ein Stimmrecht auf Landesversammlungen erhalten. Ziel ist es, die Grünen zu öffnen und möglichst viele Sympathisanten zu motivieren im November 2009 bei der Wahl der Liste für die Gemeinderatswahl 2010 teilzunehmen. „Damit dann die „Besten“ und „Fähigsten“ im Landesparlament sitzen.“ ( Quelle).
Quelle).
Spannend ist nun, welche Reaktionen die Grünen Vorwahlen ausgelöst haben. Anstatt sie als große Chance zu erkennen, befürchten Teile der Wiener Grünen offensichtlich eine feindliche Übernahme der Partei. Dies ist insofern mehr als nur traurig, da die Wiener Grünen mit dem Unterstützungsstatut auf eine Entwicklung vorbereitet wären, die meiner Meinung nach das Potential hat, die politische Entscheidungsfindung in den nächsten Jahren von Grund auf zu revolutionieren.
In diesem Kontext kommt dem Kommunikationsdienst  Twitter eine besondere Rolle zu. Anders als die zahlreichen interaktiven Freundschaftsbücher, die sich vor allem dadurch auszeichnen die bestehenden Dienste des Web (Mail, Instant Messaging, Fotogalerien, etc.) zu integrieren, hat Twitter ein neues Paradigma der Internetkommunikation etabliert. Erstmals steht eine Plattform zur Verfügung, bei der die publizierten Inhalte und deren Kommentare (anders als z.B. bei Weblogs) den gleichen Stellenwert einnehmen. Anders als bei einem Chat sind die Diskussionsbeiträge persistent, d.h. verlinkbar. Diese und weitere Eigenschaften (Kürze der Inhalte, mobile Nutzung, etc.) sind es, die Twitter zu einem optimalen Werkzeug zur Abwicklung kollaborativer Entscheidungsprozesse machen.
Twitter eine besondere Rolle zu. Anders als die zahlreichen interaktiven Freundschaftsbücher, die sich vor allem dadurch auszeichnen die bestehenden Dienste des Web (Mail, Instant Messaging, Fotogalerien, etc.) zu integrieren, hat Twitter ein neues Paradigma der Internetkommunikation etabliert. Erstmals steht eine Plattform zur Verfügung, bei der die publizierten Inhalte und deren Kommentare (anders als z.B. bei Weblogs) den gleichen Stellenwert einnehmen. Anders als bei einem Chat sind die Diskussionsbeiträge persistent, d.h. verlinkbar. Diese und weitere Eigenschaften (Kürze der Inhalte, mobile Nutzung, etc.) sind es, die Twitter zu einem optimalen Werkzeug zur Abwicklung kollaborativer Entscheidungsprozesse machen.
Bereits seit geraumer Zeit existieren im Internet Dienste, deren Stärke auf der Mitarbeit vieler einzelner Personen beruht. In einem  Vortrag erklärt Clay Shirky anschaulich, welche Stärken kollaborative Systeme im Unterschied zu institutionalisierten Arten der Zusammenarbeit haben. Eindrucksvoll lässt sich dies beispielsweise am Beispiel
Vortrag erklärt Clay Shirky anschaulich, welche Stärken kollaborative Systeme im Unterschied zu institutionalisierten Arten der Zusammenarbeit haben. Eindrucksvoll lässt sich dies beispielsweise am Beispiel  Flickr illustrieren. Der größte Teil der Bilder auf Flickr wird nicht von professionellen Fotografen erzeugt, wie sie etwa bei klassischen Nachrichtenagenturen beschäftigt sind. Es sind die Bilder derjenigen, die mit ihrer Kamera zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, die die Qualität von Flickr ausmachen. Wollte man mit einer klassischen Institution eine ähnliche Qualität erreichen, würde dies die Kosten für deren Organisation ins Unermessliche steigen lassen. Ähnliche Beispiele sind die Online-Enzyklopädie
Flickr illustrieren. Der größte Teil der Bilder auf Flickr wird nicht von professionellen Fotografen erzeugt, wie sie etwa bei klassischen Nachrichtenagenturen beschäftigt sind. Es sind die Bilder derjenigen, die mit ihrer Kamera zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, die die Qualität von Flickr ausmachen. Wollte man mit einer klassischen Institution eine ähnliche Qualität erreichen, würde dies die Kosten für deren Organisation ins Unermessliche steigen lassen. Ähnliche Beispiele sind die Online-Enzyklopädie  Wikipedia, die Videoplattform
Wikipedia, die Videoplattform  YouTube oder die zahlreichen Open Source-Softwareprojekte.
YouTube oder die zahlreichen Open Source-Softwareprojekte.
Was wir nun im Rahmen politischer Initiativen wie der Zensursula-Debatte oder den Grünen Vorwahlen erleben, ist der Einfluss, den der Siegeszug kollaborativer Systeme auf politische Entscheidungsprozesse hat. Anders als bisher, ist es zur Erreichung politischer Ziele heute nicht länger nötig, sich parteipolitisch zu engagieren. Plattformen wie Twitter ermöglichen es, Interessensgruppen kollaborativ zu organisieren. Institutionen wie Parteien oder ähnliche Interessensvertretungen verlieren an Bedeutung. Jeder Bürger hat nun die Möglichkeit, sich aktiv für jene Themen einzusetzen, die ihm am Herz liegen.
Im Kontext dessen sollte es im Interesse der etablierten Parteien sein, jene Bewegungen zu unterstützen, die dazu beitragen möglichst viele Bürger in die politische Entscheidungsfindung miteinzubeziehen.
1980: Ökologie. 2009: Internet. 1980 sind auf Basis der ökologischen Bewegung die Grünen Parteien entstanden. 2009 wird es keine neue Institution mehr sein – auch nicht die Piratenpartei. Vielmehr stehen wir an der Schwelle zu einer gänzlich neuen Form der Zusammenarbeit innerhalb unserer Gesellschaft. Spannende Zeiten!
1 Dieser Aspekt ist nur einer von vielen, die gegen die Notwendigkeit von Zensurmaßnahmen sprechen. Eine Zusammenfassung der Argumente gegen die Netzsperren findet sich beispielsweise in einem  Netzpolitik-Artikel von Lutz Donnerhacke.
Netzpolitik-Artikel von Lutz Donnerhacke.
2 Erfahrungen aus anderen Ländern legen diese Vermutung nahe. Auf der dänischen Sperrliste findet sich z.B. die URL einer niederländischen Spedition.
[AK Zensur:  Löschen statt verstecken: Es funktioniert!]
Löschen statt verstecken: Es funktioniert!]
[Lutz Donnerhacke:  Die dreizehn Lügen der Zensursula]
Die dreizehn Lügen der Zensursula]
[Christian Stöcker:  Die Generation C64 schlägt zurück]
Die Generation C64 schlägt zurück]
[Medienradio:  MR005 Zurück ins Netz!]
MR005 Zurück ins Netz!]
[Clay Shirky:  Institutions vs. Collaboratio (Video)]
Institutions vs. Collaboratio (Video)]

Flickr-Album: Sarajevo – Pale (Juli 2011)]
Fotoreportage im Eisenbahnforum Österreich]

 bei einer Demonstration, die am 20. Juni in Berlin stattgefunden hat) versucht die Internetgemeinde zu veranschaulichen, welch absurden Prozess die geplante Filterung der Webseiten darstellt. Durch bloßes Ausblenden wird Kinderpornographie nicht verhindert, sondern toleriert. Warum verfolgt die Exekutive die Anbieter dieser Inhalte nicht? Der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur hat
bei einer Demonstration, die am 20. Juni in Berlin stattgefunden hat) versucht die Internetgemeinde zu veranschaulichen, welch absurden Prozess die geplante Filterung der Webseiten darstellt. Durch bloßes Ausblenden wird Kinderpornographie nicht verhindert, sondern toleriert. Warum verfolgt die Exekutive die Anbieter dieser Inhalte nicht? Der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur hat